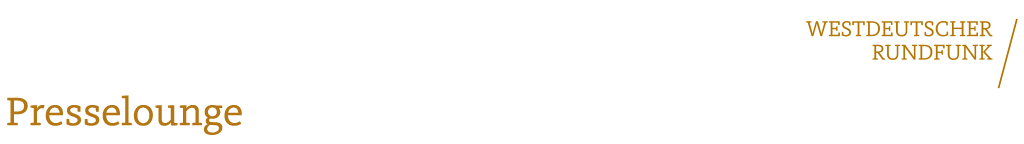Fragen an Silke Eggert und Sebastian Ladwig (Drehbuch)
„naked“
Fragen an Silke Eggert und Sebastian Ladwig (Drehbuch)

© privat/Caroline Wimmer
Erzählen Sie uns gerne, wie es zu der Idee von „naked“ kam. Was genau war Ihre Motivation?
Silke Eggert: Die Serie basiert auf persönlichen Erfahrungen, die ich als Angehörige gemacht habe. Ich wusste damals lange nicht, dass das Krankheitsbild Sexsucht überhaupt existiert, und war dementsprechend lange nicht in der Lage, mir die Hilfe zu suchen, die ich benötigt hätte. Deswegen war und ist es mir ein großes Anliegen, mit dieser fiktionalen Geschichte mehr Aufmerksamkeit für das Thema Sexsucht im Allgemeinen und im Besonderen den Auswirkungen, die diese auf eine Partnerschaft und Liebesbeziehung hat, zu generieren.
Wie haben Sie den kreativen Prozess erlebt?
Silke Eggert: Im kreativen Prozess habe ich zusammen mit meinem Co-Autor Sebastian Ladwig ein fiktives Werk geschaffen, das zwar inspiriert ist von eigenen Erfahrungen, jedoch nicht meine persönliche Geschichte erzählt. Ich habe im Prozess der Entwicklung und im Zuge meiner Recherche mit vielen Betroffenen und einigen Expertinnen gesprochen und in der kreativen Übersetzung die Geschichte von Marie und Luis geschrieben, die meiner Meinung nach einen authentischen Zyklus von Sucht und Co-Abhängigkeit erzählt. Mich hat dabei vor allem die Frage beschäftigt, welche Faktoren dazu führen, dass man, sowohl als Betroffener wie auch als Partner, in solch einer toxischen Dynamik landet.
Co-Abhängigkeit ist oft schwer zu greifen. Wie haben Sie das emotionale Gefängnis, in dem Marie steckt, erzählerisch sichtbar gemacht?
Silke Eggert: Das Wort „Co-Abhängigkeit“ ist heutzutage unter Therapeutinnen und Therapeuten ein umstrittener Begriff, da es implizieren könnte, der co-abhängige Partner sei ein schwacher Mensch. Oft ist jedoch das Gegenteil der Fall. Partner und Angehörige von Suchtkranken verfügen meist über enorme innere Ressourcen wie Ausdauer, Hilfsbereitschaft, und Empathie – alles Charakterstärken, die aber in solch einer toxischen Dynamik an Gleichgewicht verlieren und über das gesunde Maß hinausgehen. So kann die Fähigkeit, gesunde Grenzen zu setzen, im Laufe der Zeit verloren gehen und einem Muster aus versuchter Kontrolle und Kapitulation weichen.
Ich denke, das sieht man am Beispiel Marie sehr genau: Sie stellt Bedingungen, um die Situation zu kontrollieren, wie etwa, dass Luis bei ihr einzieht und zu den Meetings der Anonymen Sexsüchtigen geht. Als das nicht hilft und Luis einen Rückfall hat, steigert sich dieses Kontrollbedürfnis: Sie fängt an, Kontrollanrufe zu machen, ihm hinterher zu spionieren, schließlich sogar, seinen Computer zu hacken. Als auch das Luis nicht davon abhält, weiter seiner Sucht nachzugehen, unternimmt sie einen letzten, verzweifelten Versuch, die Sucht zu kontrollieren, indem sie sich auf Luis’ Gelüste einlässt. Ihr Feind in diesem aussichtslosen Kampf ist nicht Luis, sondern die Sucht. Denn Marie weiß, Stichwort Empathie, Luis ist kein schlechter Mensch, sondern ein kranker Mensch. Und einem kranken Menschen will man helfen. Das wissen sowohl die Angehörigen von Alkoholkranken, die die Flaschen verstecken, als auch verzweifelte Mütter, die ihren anorexischen Kindern immer wieder ihre Lieblingsspeise kochen und sie anflehen, diese zu essen. Deswegen wage ich zu behaupten, dass kein Mensch davor gefeit ist, in solch einer toxischen Dynamik zu landen. Genau das macht für mich auch die Universalität dieser Geschichte aus.
Sebastian Ladwig: Uns war wichtig, Sucht auch als eine Art Matrix oder Struktur zu erzählen, durch die man Gesellschaft generell sehr gut erzählen kann. Wir sind alle auf eine Art handysüchtig, Menschen sind sportsüchtig, Menschen sind internetsüchtig, Menschen sind pornosüchtig. Man hat das Gefühl, dass die Art von Kapitalismus, in der wir leben, dazu führt, dass man sich immer sehr schnell in bestimmte Suchtmuster begibt, um bestimmte Reize zu bedienen, die die Welt eben hat, und auch um vor der Welt zu flüchten.
Das Thema der Co-Abhängigkeit geht damit einher. Zu Anfang haben wir versucht, die Figur Luis in ihrer Sucht greifbar zu machen und im Verlauf der Handlung dann zu zeigen, dass Marie nun ähnliche Verhaltensweisen an den Tag legt. Dass sie auch anfängt zu lügen, bestimmte Muster zu decken und Luis Verhaltensweisen vor ihren besten Freunden und vor ihrer Familie beschönigt.
Wie wird die Zerrissenheit von Luis hinsichtlich Liebe, Zerstörung und Sucht im Drehbuch deutlich?
Sebastian Ladwig: Wir haben versucht, dem Ganzen eine Ebene zu geben, die nicht realistisch ist, sondern die etwas Traumartiges hat, bei der man das Gefühl hat, dass Luis von Anfang an bestimmte Wahrnehmungen plagen. Manchmal hat man für ganz kurzen Zeitpunkt das Gefühl, dass Fantasien von Luis in die Gegenwart eingreifen und er sich vorstellen muss, wie sich eine Person, die ihm gegenüber sitzt, in eine sexuelle Pose begibt. Ihn lüstern anschaut, sich über die Lippen leckt. Und das auch bei Menschen, bei denen er das gar nicht will. Uns war wichtig zu zeigen, dass er ein Getriebener ist.
Haben Sie auf die Beratung durch Expertinnen und Experten zurückgegriffen?
Sebastian Ladwig: Ich stand mit Gruppen von pornosüchtigen Männern in Kontakt und konnte während der Pandemiezeit online, also als stiller Beobachter, an verschiedenen Runden teilnehmen. Dafür musste ich keine Ersatzidentität erfinden, was sich falsch angefühlt hätte.
Diese Erfahrung hat mich von sehr vielen Vorurteilen befreit, weil die Menschen, die mir da begegnet sind, sehr normal, sehr alltäglich waren, keine Stereotypen bedient haben, sondern aus allen Lebensbereichen kamen. Was alle geteilt haben, war, dass die nicht ernst genommen wurden, dass ihr Umfeld ihnen gespiegelt hat, so etwas wie Sexsucht gibt es gar nicht, das ist kein Problem. Auch Scham hat eine extrem große Rolle gespielt, weil man immer wieder gemerkt hat, dass sie sich selbst dafür hassen, wie sie sind, wie sie glauben zu sein, wie sie geworden sind. Auch dass es ein Riesenschritt für sie war, sich zu öffnen. Wie bei vielen Süchten hat man gemerkt, dass teilweise schon andere Suchtstrukturen in der Familie da waren, beispielsweise Eltern, die Alkoholiker waren. Ich hatte das Gefühl, das war ein sehr breiter Querschnitt durch die Gesellschaft.
Was möchten Sie ihrem Publikum durch die Serie mitgeben?
Silke Eggert: Mir ist während des Schreibprozesses klar geworden, dass ich hier nicht nur eine schmerzhafte Erfahrung verarbeite, sondern auch eine große Liebesgeschichte erzähle. Nicht die Art von Liebesgeschichte, die man in einer Romantic-Comedy sieht, aber dennoch eine Liebesgeschichte. Und zwar einmal die Geschichte von der Liebe zwischen Marie und Luis, und dann die Geschichte von der Liebe Maries zu sich selbst.
Was mir wichtig ist, zu vermitteln: „Wenn du eine ähnlich schmerzhafte Erfahrung gemacht hast – was hast du dennoch daraus gezogen? Was hast du gelernt? Inwiefern hat diese Erfahrung dich reicher gemacht an Wissen, an Selbsterkenntnis? Kannst du trotzdem die Liebe sehen?“
Des Weiteren war mir und Sebastian wichtig, die verschiedenen Spielarten von Sucht zu erzählen, die unsere Gesellschaft dominieren und die diese auch hervorbringt. Unser Arbeitstitel war „Verlangen“ – es geht also bei jeder einzelnen Figur um das Verlangen, das sie umtreibt, um Sehnsüchte, die einem Mangel entspringen, oft einem Mangel an zwischenmenschlicher Nähe. Diesen Mangel aufzuzeigen, und dafür aber auch eine Lösung anzubieten, war mir wichtig.
Sebastian Ladwig: Ein Verständnis dafür, dass wir in unserer Gesellschaft in Suchtstrukturen leben: Die Beziehung von Luis und Marie ist, glaube ich, ein gutes Beispiel für die Art und Weise, wie wir in unserer Gesellschaft leben, in der wir alle irgendwie süchtig sind, wie auch immer diese Süchte aussehen. In der wir das Gefühl haben, nie genug zu kriegen. Ich glaube, es kann ganz befreiend sein, diese Strukturen in „naked“ so in der Extremform zu sehen, dann auch zu verstehen, wie sie funktionieren.
Stand: 20.08.2025, 11.00 Uhr