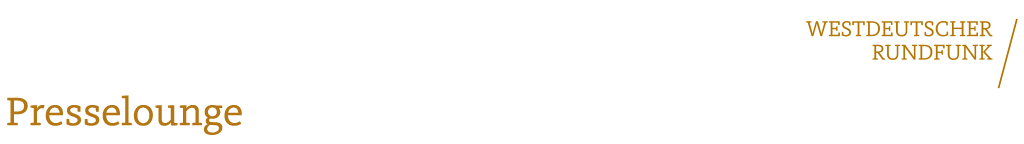Interview mit Autor Ingo Haeb
Interview mit Autor Ingo Haeb

Ingo Haeb
© WDR/Panama Pictures
Herr Haeb, was hat Sie an der Thematik gereizt, was gab den Ausschlag, darüber einen Spielfilm zu machen?
Ich bin unweit des Braunkohle-Tagebaus aufgewachsen, als Kind habe ich die Bagger bestaunt. Jetzt interessiert mich vor allem das starke Heimatgefühl der Menschen, die umsiedeln müssen – vermutlich, weil ich es selbst nicht habe. In all den Reportagen, die ich im Fernsehen über die Umsiedlungen gesehen habe, war von diesem Verlustschmerz die Rede, aber ich habe ihn nie mitfühlen können. Als ich mit den Leuten vor Ort gesprochen habe, verstand ich, dass sich die eigentlichen Dramen zum einen im Privaten abspielen und zum anderen ganz subtil über Jahre ziehen. Da war für mich klar, dass wir einen Spielfilm brauchen, um das abzubilden.
Dieser sollte jedoch kein Widerstandsdrama werden. Die Veränderungen schleichen sich ein, drum herum scheint das Leben normal weiter zu gehen. Aber die Dorfgemeinschaften zersplittern, wie auch Freundschaften und Familien kaputt gehen, weil die Menschen sich nicht auf eine gemeinsame Erinnerungskultur einigen können. Das Spektrum reicht von Verdrängung bis zum manischen Widerstand. Jede dieser Strategien ist nachvollziehbar, aber sie isolieren die Menschen auch voneinander.
Wie kam es dazu, die Geschichte anhand einer Bäckerfamilie erzählen?
Von den letzten Dörfern, die umgesiedelt werden sollten, hatte nach dem Abriss von Immerath nur noch Keyenberg so etwas wie einen Dorfkern mit Infrastruktur. Da gab es eine Metzgerei, eine Sparkasse, einen Tante-Emma-Laden, mehrere Gaststätten – und eben die Bäckerei. Das Drama der Umsiedlung ist für eine Familie, die auch ein Gewerbe im Ort betreibt, noch einmal größer. Außerdem ist so eine Bäckerei natürlich Treffpunkt für alle, die etwas auf dem Herzen haben.
In der Praxis war dies ein ungewöhnliches Projekt: einen Spielfilm über mehrere Jahre zu erzählen und aktuelle Ereignisse einzuflechten. Worin lagen die Herausforderungen?
Die größte Herausforderung – neben Corona – war, dass jeder Drehort jederzeit von RWE gekauft und damit für uns verschlossen werden könnte. Wir hatten zum Beispiel anfangs einen sehr guten Draht zur Küsterin aus Keyenberg und wollten eigentlich auch noch in der Kirche dort drehen. Aber dann wurde die Küsterin entlassen und das Bistum verkaufte die Kirche.
Wie sind Sie auf den Cast gekommen? Was sollte dieser mitbringen, was hat diesen ausgezeichnet?
Das Ensemble sollte den Spagat zwischen volkstümlich und lebensnah beherrschen. Johanna Gastdorf und Markus John kenne ich schon sehr lange. Johanna ist eine sehr besondere Schauspielerin, weil sie diese Wärme und auch einen subtilen Witz mitbringt. Sie hat sich voll und ganz auf die Figur Marita eingelassen und auch schon mitgespielt, als wir noch keinen Cent Budget hatten. Markus hat eine enorme Präsenz und wie er Rheinländer darstellt, ist schlichtweg einmalig. Immer haarscharf an der Grenze zur Parodie, aber trotzdem wahrhaftig und empathisch. Wir brauchten ihn als Anker mit dem richtigen Dialekt. Merle Wasmuth und Petra Nadolny haben das Ensemble großartig ergänzt und es nicht selten sogar zusammen gehalten. Dass sie tatsächlich aussehen wie Mutter und Tochter ist ein zufälliger Bonus. Besetzt habe ich sie wegen ihrer Fähigkeiten, wie aus dem Leben spielen zu können.
Worin lag der Vorteil, dass die Schauspieler über einen so langen Zeitraum in dieses Projekt involviert waren?
Die Schauspieler:innen haben mit den Dörfern gelitten. Sie haben gesehen und durch viele Gespräche mit den Menschen vor Ort verstanden, wie es sich anfühlt, wenn man immer bangen muss, seine Heimat zu verlieren. Wenn man in einem Jahr alle Gespräche führen muss, für die andere Familien viele Jahre haben, weil für alle Generationen gleichzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt werden müssen.
Wann und warum holten Sie Regisseurin Gina Wenzel ins Boot?
Ich habe für mich selbst entdeckt, dass ich gerne etwas artifiziell und theatral inszeniere, wie zum Beispiel beim „Zimmermädchen Lynn“. Bei „Eher fliegen hier UFOs“ war es aber wichtig, einen bestimmten lebensnahen Ton zu treffen und dabei trotzdem all die Details aus dem Drehbuch zu bewahren, denn das Thema ist vergleichsweise komplex für einen Film. Ich kenne Gina schon lange und weiß, dass sie genau für so einen Ton das richtige Händchen hat. Sie arbeitet einfach gerne mit Schauspieler:innen und ist zudem eine wunderbar ehrliche und gradlinige Type. Gina war einfach ein Glücksfall für unser Projekt.
Interview: Gitta Deutz
Stand: 18.10.2023, 11.15 Uhr