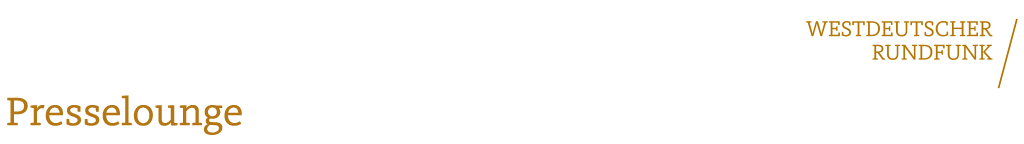Ein Gespräch mit Tom Fährmann
Ehrenpreis des DEUTSCHEN KAMERAPREISES
Ein Gespräch mit Tom Fährmann
„Wenn ein Regisseur genau weiß, wie sein Film aussehen soll, dann sucht er sich besser einen anderen Kameramann als mich“

Tom Fährmann
© Filmproduction-apetech
Woher rührt Ihre Faszination für die Arbeit mit der Kamera?
Ich bin schon früh zum Fotografieren gekommen. Mein Vater hatte eine Rolleiflex, die ich aber nicht benutzen durfte. Also habe ich mein Taschengeld gespart, zehn Pfennig in der Woche, und bei Neckermann für 3 Mark 95 eine chinesische, doppeläugige 6x6-Kamera gekauft. Der Rollmechanismus war kurze Zeit später im Eimer. Aber ich habe die Kamera nicht weggeworfen, sondern immer wieder oben reingeschaut. Diese Konzentration auf einen Ausschnitt der Welt hat mich absolut fasziniert. Da war ich vielleicht acht Jahre alt.
Sind Fotografieren und Filmen grundlegend unterschiedliche Arbeiten?
Für mich ist das Fotografieren die wesentlichere Arbeit. Ich fotografiere viel zwischen den Filmen. Da gibt es keinen Aufnahmeleiter, der die Zeitpläne im Blick hat und zur Eile drängt. Dann bin ich allein und erfinde meine Bilderwelten. Das Fotografieren ist für mich zugleich eine Bilderquelle fürs Filmen. Ich transferiere unheimlich viel von der einen Welt in die andere. Wenn ich ein Filmprojekt vorbereite, stelle ich Bilder aus Büchern zusammen, in denen ich Stimmungen sehe, die zum Film passen könnten. Diese Mood-Boards präsentiere ich dann den Regisseuren und Regisseurinnen.
Aus welchen Büchern ziehen Sie diese Inspirationen?
Bei jeder Auslandsreise suche ich in den Städten nach Bücherläden und wühle mich durch die Fotobücher. Ich möchte wissen: Wie sehen andere Fotografen die Welt? Welche Stimmung und welche Atmosphäre haben Sie festgehalten? Früher, wenn ich für eine Werbung in die Staaten geflogen bin, habe ich oft meine ganzen Klamotten dort gelassen und bin mit einem Koffer voller Bücher zurückgekommen. Zum Glück finde ich auch heute noch solche Bücherläden, aber es wird immer schwieriger.
Haben Sie sofort Bilder im Kopf, wenn Sie ein Drehbuch lesen?
Nein, gar nicht. Wenn ich ein Drehbuch zum ersten Mal lese, versuche ich möglichst wenig in Bildern zu denken. Ich überlege nur: Mag ich die Figuren? Glaube ich die Dialoge? Ich will die Geschichte verstehen und von ihr berührt werden. Als ich an der Filmhochschule München studiert habe, gab es damals dort nur die Regieausbildung. Vielleicht ist das ein Grund, warum ich bis heute so eng an den Geschichten arbeite. Die Bilder ergeben sich erst ab dem zweiten Lesen des Drehbuchs, dann aber sehr intensiv. Ich kann mir kein Filmprojekt vorstellen, zu dem ich mich im Vorfeld nicht ganz genaue Vorstellungen gemacht habe. Ich bekomme Panik, wenn ich improvisieren soll. Ich möchte alles durchdacht und begriffen haben.
Was braucht ein guter Kameramann dringender: künstlerisches Talent oder technisches Können?
Talent hat noch nie ausgereicht. Wenn man spürt, dass man sehr schnell Klavier lernt, muss man trotzdem noch 20 Jahre hart arbeiten, bis aus dem Talent ein guter Pianist wird. Talent ist eine Voraussetzung, aber keine Lösung für eine berufliche Tätigkeit. Die Kameratechnik muss man verstehen und bedienen können. Aber die Kamera ist vor allem ein Werkzeug für den Gestalter. Jeder Kameramann sollte auf der einen Seite ein guter Ästhet sein und auf der anderen Seite ein guter Techniker. Das geht bei den Menschen nur selten zusammen. Es gibt ästhetisch orientierte Menschen, die in technischer Hinsicht eine Katastrophe sind. Und es gibt technisch orientierte Menschen, da will man gar nicht wissen, wie deren Wohnung eingerichtet ist.
Wie haben Sie Ästhetik und Technik unter einen Hut gebracht?
Ich bin als Linkshänder aufgewachsen. Als ich in die Schule kam, wurde ich – wir sprechen über den Anfang der 60er-Jahre – gezwungen, mit der rechten Hand zu schreiben. Dabei wurden meine beiden Gehirnhälften umgepolt: Die emotionale musste plötzlich logisch sein und umgekehrt. Das hat mir bis zum frühen Erwachsensein ein starkes Stottern eingebracht. Ich konnte nicht flüssig sprechen. Das hat sich erst geändert, als ich zur Filmhochschule ging. Heute denke ich, dass dieser Wechsel der beiden Gehirnhälften dafür gesorgt hat, dass ich sowohl technisch als auch ästhetisch bestimmte Kompetenzen entwickeln konnte. So stelle ich mir das vor, aber vielleicht stimmt das auch gar nicht.
Können Sie mit Ihrer Arbeit die Dramaturgie eines Films bestimmen?
Ich habe nicht das Gefühl, dass ich die Dramaturgie eines Films bestimme. Aber wer mich als Kameramann engagiert, bekommt jemanden, der sich zum Inhalt äußerst. Ich frage mich bei jeder Szene: Fängt die am richtigen Punkt an und hört die am richtigen Punkt auf? Muss die Szene zu dieser Tageszeit spielen? Ich will jedes Detail kennen und verstehen. Bei „Death of a Superhero“ gab es ein regelrechtes Speeddating zwischen dem Regisseur und vier Kameraleuten. Einer nach dem anderen durfte dort in einem Münchner Café vortanzen. Ich habe mit Ian FitzGibbon überhaupt nicht über die Bilder geredet, sondern nur über die Figuren. Bei der Rolle der Mutter gab es Details, die meiner Meinung nach einfach nicht zusammenpassten. Da schaute mich der Regisseur an und sagte: „Die Schauspielerin hat auch gesagt, dass etwas nicht stimmt.“ An diesem Punkt wird er sich gedacht haben, dass ich bei seiner Arbeit eine Hilfe sein könnte. Wenn ein Regisseur genau weiß, wie sein Film aussehen soll, dann sucht er sich besser einen anderen Kameramann als mich.
Nach welchen Kriterien suchen Sie sich die Regisseure aus?
Das läuft umgekehrt. Die Regisseure suchen uns aus. Das Tolle bei der Arbeit eines erfolgreichen Kameramannes ist, dass er sich um nichts kümmern muss. Er wird ständig gefragt. Aber wenn das nicht so ist, kann er nicht auf den nächsten Regisseur zugehen und sagen: „Hallo, ich würde gern mal mit Dir arbeiten.“
Was schätzen Sie an einem guten Regisseur?
Am liebsten sind mir Regisseure, mit denen ich im Vorfeld genau besprechen kann, wie der Film aussehen soll, und die sich dann um die Schauspieler kümmern und mir die Bilder überlassen. Das ist ein recht martialisches Bild, aber ich sehe uns als zwei Kämpfer in der Schlacht, die Rücken an Rücken stehen. Ich bewältige die 180 Grad in meinem Blickfeld und kann mich darauf verlassen, dass ich mich um die 180 Grad hinter mir nicht kümmern muss. Da steht ja der Regisseur. Der muss sich aber auch nicht um meine 180 Grad kümmern. Da stehe ich. Diese vertrauensvolle Zusammenarbeit gefällt mir sehr gut. Als ich meinen Abschlussfilm gemacht habe, der ja ein Regie-Abschlussfilm sein musste, habe ich mich so einsam wie noch nie gefühlt. Ich war der Einzige, der den Film machen wollte, die anderen wollten im Wesentlichen nach Hause. Wenn der Regisseur und der Kameramann am Set zwei vertrauensvolle Sparringpartner sind, dann ist das für beide hervorragend.
Greifen Sie manchmal in die Regie ein?
Nein. Ich greife nicht ein, aber ich gehe schon mal zum Regisseur und sage, dass wir noch eine Variante drehen könnten. Ich glaube, dass ich diese Kompetenz habe, weil ich eine Reihe von Drehbüchern mit geschrieben oder mit umgeschrieben habe. Aber ich gehe nie direkt zum Schauspieler und gebe ihm Anweisungen. Das wäre ein großer Kamerafehler.
Welche Beziehung haben Sie bei der Arbeit zu den Schauspielern und Schauspielerinnen?
Ich versuche, sehr intensive Beziehungen aufzubauen. Ich weiß am Abend eines Drehtages den Namen von jedem einzelnen Komparsen. Den habe ich zwar am nächsten Tag wieder vergessen, aber wenn wir drehen, spreche ich jeden mit Namen an. Mir ist wichtig, dass sich alle gut aufgehoben fühlen. Ich spreche auch mit Hauptdarstellerinnen darüber, wie ihr Gesicht gebaut ist und wie wir verhindern können, dass es nicht gut aussieht. Meist bitte ich nach Maskenproben auf einen Kaffee und spreche ganz offen darüber, wo ich die Probleme sehe. Wenn man das diplomatisch vernünftig angeht, sind sie alle froh, dass sich jemand die Mühe macht, ein Gesicht zu lesen und alles dafür tut, dass es klasse aussieht.
Wie stark berührt Sie eine Szene, die vor Ihrer Kamera gespielt wird?
Ich kann beim Drehen Momente großer Rührung entwickeln. Es gab mal eine Szene mit Gert Voss, die mir im Drehbuch eher kitschig vorkam. Als er sie dann spielte, hatte ich so viele Tränen in den Augen, dass ich das Bild nicht mehr richtig sehen konnte. Ich war überwältigt. Wir Kameraleute sind ja inzwischen oft die einzigen Heads of Department, die sich noch in der Nähe der Schauspieler befinden. Nur ein Beispiel: eine Schauspielerin spielt eine Mutter, die erfährt, dass ihr Kind bei einem Umfall umgekommen ist. Das kann sie nicht einfach runterrotzen, sondern sie muss es fühlen. Gleich nach der Szene heißt es „Cut!“, der Aufnahmeleiter brettert ins Set und lässt alles umbauen. Die Frau steht aber immer noch da mit dieser Emotion. Dann gehe ich halt hin und versuche, sie aufzufangen. Ich muss dafür sorgen, dass die Schauspieler sich sicher, aber zugleich frei fühlen. Bei mir sind Markierungen auf dem Boden etwas, das man ungefähr treffen muss, aber nicht genau. Ich drangsaliere niemanden in ein Licht hinein: Dann steht er da womöglich super ausgeleuchtet, aber spielt schlecht. Ich tue alles dafür, dass sie frei spielen können.
Mit Sönke Wortmann haben Sie sechs große Kinofilme in circa 20 Jahren gedreht. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
Als mir die Constantin „Das Superweib“ anbot, drehte ich gerade mit Nico Hofmann den Film „Der Sandmann“. Dann kam das Drehbuch, und Nico fragte mich eines Abends, wie mir Sönkes Buch gefällt. Ich sagte, dass ich es grottenschlecht finde und absagen werde. Da hat mich der Nico richtig zusammengestaucht. Er meinte, Sönke habe gerade mit „Der bewegte Mann“ einen Riesenerfolg und ich müsse auf jeden Fall für seinen nächsten Kinofilm zusagen. Damals gab es noch keine Handys, deshalb habe ich aus der Lobby des Hotels bei der Constantin angerufen und zugesagt. Der Film war dann, wie ich vermutet hatte. Aber er hat eine lange Zusammenarbeit zwischen Sönke und mir begründet. Das war so ein Rücken-an-Rücken-Kampf, wie ich ihn vorhin beschrieben habe. Sönke hat immer sehr intensiv mit den Schauspielern gearbeitet und mich sehr stark meine Bilderwelt bauen lassen. Das war das Geheimnis unserer Zusammenarbeit, die ich als sehr erfolgreich empfunden habe.
Nach „Der Campus“ haben Sie für „St. Pauli Nacht“ ein zweites Mal Hamburg in Szene gesetzt. Wie sind Sie dabei vorgegangen?
„St. Pauli Nacht“ ist einer meiner Lieblingsfilme. St. Pauli wird fast immer in blauen Nächten und mit roten Neonreklamen gezeigt. Ich wollte das ganz anders machen. In London hatte ich ein dünnes Fotobuch entdeckt, das nächtliche Stadtporträts mit einer Melange aus dem Orange von Natrium-Dampflampen und dem Grün von Quecksilber-Dampflampen zeigte. Genau so wollte ich St. Pauli zeigen, anstatt auf die üblichen Klischees zu setzen, die jeder mit diesem Stadtteil und dem Rotlichtmilieu in Verbindung bringt.
„Das Wunder von Bern“ war die erfolgreichste Zusammenarbeit mit Sönke Wortmann. Wie haben Sie die Arbeit empfunden?
„Das Wunder von Bern“ war für Sönke und mich ein ganz besonderer Film. Wir sind beide in diesem Ruhrgebiet aufgewachsen. Wir kannten das alles ganz genau. Als ich zu diesem Projekt kam, war die Ausstattung schon recht weit. Mir gefiel aber nicht, dass alles in Sepia-Braun gedreht werden sollte. Schwarzweißfilme bekommen diesen Braunstich ja nur, wenn sie nicht vernünftig fixiert wurden. Das ist allerdings kein Grund, historische Filme immer nur braun zu drehen. Ich hatte andere Erinnerungen an das Ruhrgebiet, deshalb haben wir den Film in Cyan-Grün gedreht. Es war nicht einfach, das durchzusetzen, aber am Ende haben wir es so gemacht. Das hat sehr gut funktioniert.
Wie haben Sie die berühmten Spielzüge der Weltmeisterschaft 1945 auf die Leinwand gebracht?
Sönke war früher Berufsfußballspieler. Er wollte niemanden auf dem Platz haben, der nicht zumindest in einer unteren Liga Fußball spielt. Es hat mich schlaflose Nächte gekostet, wie wir ein Fußballspiel auf 35 Millimeter drehen sollen. Uns war wichtig, komplette Spielzüge zu drehen und nicht nach jedem Schuss einen Schnitt zu setzen. Also habe ich Kontakt zu Premiere aufgenommen und gesagt, dass ich die fünf besten Kameramänner brauche, die normalerweise bei Fußballübertragungen im Fernsehen zum Einsatz kommen. Jeder hatte eine 35-Millimeter-Kamera mit Video-Ausspielung. Die Signale gingen in einen Ü-Wagen und wurden von einem fernseherprobten Fußball-Regisseur kombiniert. Der braucht ganz andere Fähigkeiten als ein Regisseur, der mit Schauspielern arbeitet.
In welchem Stadion haben Sie gedreht?
Wir brauchten eine riesige Green Screen, die wir mit Gerüsten in einem Stadion aufbauen wollten. Die Vereine hatten aber Angst um ihren Rasen. Irgendwann habe ich erkannt, dass wir gar kein Fußballstadion brauchen, sondern nur eine Rasenfläche. So haben wir in der Nähe von Aachen eine Firma gefunden, die auf ihren Äckern Rollrasen produziert. Dort haben wir eine Green Screen aufgebaut, die 110 Meter lang und sieben Meter hoch war. Als ich das erste Mal über den Hügel fuhr und dieses Set sah, ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Diese Dimensionen waren erschreckend, aber der Aufwand hat sich gelohnt. Im Gegensatz zu den Fernsehbildern wollten wir die Spieler auf Augenhöhe zeigen. Wir sind mit der Steadycam auf dem Spielfeld herumgerannt und haben die einstudierten Spielzüge wie eine Schlacht und nicht wie ein Fußballspiel gefilmt. Ich weiß noch, dass Sönke mich kurz vorher bat, doch noch eine zusätzliche Kamera auf einen Steiger zu stellen. Er wollte zur Sicherheit eine Totale haben, damit man weiß, wie sich die Teams gerade gegenüberstehen. Im fertigen Film waren dann aber fast nur die nahen Aufnahmen zu sehen.
Sie haben bei „Das Wunder von Bern“ intensiv an den visuellen Effekten mitgearbeitet. Wie weit war diese Technik zur Jahrtausendwende?
Wir hatten 127 Schüsse mit dieser Green Screen. 122 davon waren zum damaligen Zeitpunkt richtig gut. Ich habe hinterher aber fast nur über die fünf anderen sprechen müssen. Bei denen haben wir nicht erreicht, was wir uns zum Ziel gesetzt hatten. Ich habe damals noch neun Monate ohne einen Vertrag, ohne eine finanzielle Absprache als Creative Director an den visuellen Effekten mitgearbeitet. Denn meine Verantwortung als Bildgestalter endet nicht am letzten Drehtag. Wir haben zu einem sehr frühen Zeitpunkt versucht, einen Film digital zu gestalten. Wir mussten ihn sogar um ein Jahr verschieben, weil es vorher überhaupt nicht möglich war, unsere erhofften Bilder am Computer zu generieren. Wenn man vor wenigen Jahren „Trautmann“ von Markus R. Rosenmüller gesehen hat und den mit „Das Wunder von Bern“ vergleicht, sieht man sehr deutlich, wie sich die visuellen Effekte in 20 Jahren weiterentwickelt haben.
Für die Romanverfilmung „Die Päpstin“ haben Sie mit Sönke Wortmann das Mittelalter aufleben lassen. Wie sind Sie dabei vorgegangen?
Die Bildgestaltung begann wieder mit einem Fotobuch. Ich hatte das Porträtbuch eines spanischen Fotografen gefunden, der mit Negativen im Großformat 8 x 10 Inch, also etwa Din A4, Clochards von der Straße ins Studio gebeten und dort fotografiert hatte. Man sieht jedes Detail wie die entzündeten Nagelbette, die fehlenden Zähnen, die schwarzen Fingernägel, die roten Augen, also all das, was mit einem Menschen passiert, wenn man unter solchen Bedingungen leben muss. Mich diesem Buch ging ich zum Chefmaskenbilder und fragte ihn, ob er sich vorstellen kann, dass unsere Figuren so aussehen? Denn wenn ich etwas hasse, dann sind das historische Filme, die wie ein Bauernhofmuseum wirken, mit Nonnen im blütenweißen Talar, die um das Jahr 1400 irgendwo um die Ecke eine Miele-Waschmaschine stehen haben.
Greift die ganze Produktion Ihre Ideen immer begeistert auf?
Ich erinnere mich an große Auseinandersetzungen mit der Kostümbildnerin, die gern die Kostüme auf einem Zustand halten wollte, in dem man sie später gut wieder verkaufen kann. Ich wollte aber Kostüme, denen man ansieht, dass die Menschen sie seit zwei Jahren täglich tragen. Es gab damals andere Hygienevorstellungen als heute. Nur eine Ausnahme haben wir gemacht: Die Zähne der Schauspielerinnen und Schauspieler durften bleiben, wie sie sind. Aber Tonsuren wurden rasiert. Wer dazu nicht bereit war, bekam die Rolle nicht. Wir haben ganz intensiv daran gearbeitet, dass alles so aussieht, wie wir es uns im achten Jahrhundert vorstellen. Ein Problem war, dass die alten Hütten keine Fenster hatten. Da gab es nur eine Tür und oben ein kleines Rauchloch. Ich habe lange überlegt, wie wir dort Licht machen sollen? Eines nachts fiel mir ein, dass wir das Gebälk nicht lichtschlüssig auf die Mauern aufsetzen, sondern kleine Schlitze lassen, die wir von außen beleuchtet haben. Der Setdesigner war damit einverstanden, und so bekam man zumindest eine Idee davon, dass bestimmte Szenen am Tag und nicht in der Nacht spielen. Wir haben auch viel mit Fackeln gearbeitet. Ich liebe es, mit verschiedenen Lichtquellen eine Atmosphäre am Set zu schaffen. Wenn dann die Schauspieler ins Bild kommen und alles genauso aussieht, wie ich mir das erträumt habe, dann kann ich kein größeres Glück in meinem Leben benennen. Das klingt vielleicht doof, aber es ist so.
Hat das hohe internationale Budget für „Die Päpstin“ die Kreativität eher gefördert oder gehemmt?
„Die Päpstin“ war ein enormer Aufwand, aber die Produktion lief ab wie ein Uhrwerk: Wir hatten 63 Drehtage angesetzt, aber waren nach 60 Drehtagen fertig. Wir haben mit drei Kameras gedreht, und alles lief hervorragend. Danach dachte ich, jetzt kann mich nichts mehr schocken. Jetzt kann mir jedes noch so große Filmprojekt angeboten werden. Das Irre war aber: Es kam gar nichts danach. Damit habe ich niemals gerechnet. Also drehte ich nach „Die Päpstin“, die 22 Millionen gekostet hatte, einen Youngster-Film mit einem Budget von 1,2 Millionen. Das war „Death of a Superhero“, dessen Regisseur ich bei diesem Speeddating in München kennengelernt hatte.
Wie waren die Dreharbeiten in Irland?
Ich war fasziniert von der Authentizität der irischen Schauspieler. In Deutschland sagen sie oft, dass sie gern noch eine Aufnahme machen würden, weil sie mit den ersten nicht ganz zufrieden waren. Das kennt man in Irland nicht. Wenn dort der Regisseur nicht sagt, dass er noch eine Aufnahme haben will, dann war alles okay. Ich muss sowieso sagen, dass die Zusammenarbeit mit Ian FitzGibbon die emotional intensivste Freundschaftsarbeit war, die ich jemals mit einem Regisseur erlebt habe. Davon erzähle ich auch gern an der Filmhochschule: Ein Buddy-Verhältnis muss keine lange Vorgeschichte haben, das kann auch – wie in diesem Fall – mit einem Speeddating beginnen.
Hätte Sie statt Irland auch Hollywood gereizt?
Hollywood war nie eine Option für mich. Es gab mehrere ernstzunehmende Möglichkeiten, nach Amerika zu gehen. Ich wollte da aber nie hin. Ich kann mit dieser Lebensweise nichts anfangen. Wann immer ich dort war, saßen die Deutschen hinten in irgendeiner Kneipe und blieben unter sich. Da fand keinerlei Integration statt. Und diese übertriebene gute Laune und Angeber-Nummer waren einfach nicht meine Welt.
Mit Volker Schlöndorff waren Sie in Kasachstan, um „Ulzhan – Das vergessene Licht“ zu drehen. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit, für die Sie auch den Deutschen Kamerapreis gewannen?
Volker Schlöndorff hatte mich schon bei einem früheren Film gefragt, ob ich die Kamera machen möchte. Ich fuhr nach Berlin und sprach mit ihm über das Drehbuch. Irgendwann schaute er mich an und meinte: „Herr Fährmann, Ihnen ist schon klar, dass Sie nicht Regie führen sollen?“ Daraus wurde dann nichts. Aber beim nächsten Film hat er mich erneut gefragt. Ich fand den Stoff sehr spannend und melancholisch. In meiner westlichen Arroganz wusste ich nichts über Kasachstan, obwohl das Land so groß ist wie ganz Europa. Wir denken oft, die ganze Welt ist fotografiert und es gibt nichts mehr zu entdecken. Aber in Kasachstan fanden wir weite Landschaften und fantastische Motive, bei denen sich von ganz allein ein 3D-Gefühl einstellt.
Wie verliefen die Dreharbeiten in Kasachstan?
Das war vermutlich der härteste Film, den ich jemals gedreht habe. Mein Magen ist sehr empfindlich und nicht kompatibel mit dem Catering in Kasachstan. Die meiste Zeit habe ich mich von Hipp-Babynahrung ernährt. Ich stand in einem Supermarkt und mein Blick fiel auf das Regal mit diesen Gläschen, die ich dann alle gekauft und in den nächsten Wochen gegessen habe. Volker Schlöndorff ist an zwei oder drei Sonntagen mit mir zwei Stunden über Huckelpisten zu einem Hyatt Hotel gefahren und hat mich zum Brunch eingeladen, aus lauter Mitleid. Die Dreharbeiten waren ein Horror, aber es war eine tolle Zusammenarbeit mit Volker Schlöndorff. Ich mochte seine Klugheit, da konnte ich eine Menge lernen.
Hatten Sie und Volker Schlöndorff ähnliche Vorstellungen, wie der Film aussehen sollte?
Wir hatten eine sehr spannende Auseinandersetzung über Nahaufnahmen. Als alter, linker Autorenfilmer wollte Volker Schlöndorff die Leute immer gern von hinten zeigen. Er meinte, schon Billy Wilder habe gesagt, dass man Schauspielern in Nahaufnahmen bei der Arbeit zuschaut. Ich glaube nicht an diese These. Wir einigten uns darauf, dass ich gern die Aufnahmen von hinten mache, aber die verbleibende Zeit nutze, um noch Nahaufnahmen von vorne zu machen. Das Lustige war, dass die später fast alle im fertigen Film zu sehen waren. Wir hatten uns übrigens auf die Regel geeinigt: Die Kamera bewegt sich nicht, wenn sie kann, sondern nur, wenn sie muss. Irgendwann wollte Volker Schlöndorff davon abweichen, weil die Dreharbeiten so anstrengend wurden. Ich sollte die Kamera einfach auf die Schulter nehmen und irgendwie zu Ende drehen. Ich habe dem widerstanden. Bei der Premiere bedankte er sich für meine Hartnäckigkeit und Sturheit, ohne die der Film nicht diese wunderbare Form bekommen hätte. Das fand ich toll von ihm.
Viele erfolgreiche Kameramänner wurden zu Regisseuren. Hat Sie das nie gereizt?
Nein. In den letzten zehn oder zwölf Jahren ist nach fast jedem Film die Produktion auf mich zugekommen und hat mir gesagt, dass ich bei ihnen Regie führen darf, wenn ich das machen möchte. Ich will das aber nicht. Die Arbeit des Regisseurs ist mir zu einsam und zu langwierig. Ich bin ein Sprinter, ich komme gern zur Vorbereitung, drehe den Film, trinke am Ende ein Glas Champagner mit und verabschiede mich. Die Dreharbeiten sind mein Leben. Ich möchte nicht in der Vorbereitung viele Monate lang um Geld kämpfen müssen oder hinterher noch etliche Wochen im Schneideraum sitzen. Bei der Werbung habe ich oft Kamera und Regie gemacht, aber das war grenzwertig von der Belastung her. Es ist schon sinnvoll, dass diese Aufgaben beim Film auf zwei Personen verteilt sind. Hinzu kommt noch, dass Regisseure ihre Filme auch nach außen repräsentieren und verteidigen müssen. Dieser ganze Öffentlichkeitswahnsinn ist mir zuwider. Ich habe oft erlebt, welcher Rummel um bekannte Regisseure gemacht wird, wenn sie ein Restaurant betreten. Solch ein Prominentenstatus passt in keiner Weise zu mir.
Zum Schluss die Gretchenfrage: analog oder digital?
Ich habe seit 17 Jahren einen Beratervertrag mit der ARRI und war auch intensiv an der Entwicklung der digitalen Alexa-Kamera beteiligt. Lange Zeit habe ich gesagt: Wenn digitale Kameras von der Qualität her schlechter sind als der analoge Film, dann wäre ich ja bekloppt, wenn ich wechseln würde. Mit der Alexa haben wir eine Qualität erreicht, bei der die Bilder mindestens genauso gut sind wie beim analogen Film. Ich bin auch froh, dass ich sofort ein fertiges Bild sehen kann und nicht mehr schlaflose Nächte habe, ob irgendwas auf dem Film ist. Das fand ich immer sehr belastend. Der größte Vorteil an der digitalen Technik ist aber sicherlich, dass heute junge Filmemacher mit überschaubarem Budget ihren eigenen Kinofilm drehen können. Das wäre mit analogem Film nicht möglich gewesen. Ich glaube, dass vor allem die Kunst- und Arthaus-Filme davon langfristig profitieren werden.
Stand: 06.05.2022, 14.00 Uhr