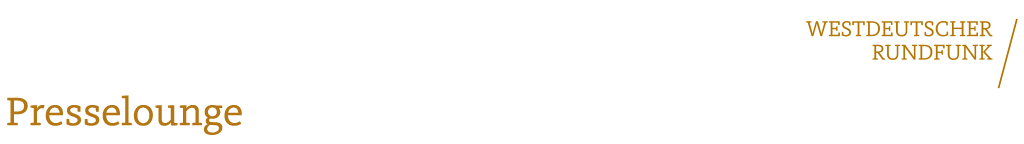Anwältin Beatrix Hüller im Gespräch
Verunsichert – Alles Gute für die Zukunft
Anwältin Beatrix Hüller im Gespräch
„Letztlich kocht ein Versicherer auch nur mit Wasser“
„Verunsichert – Alles Gute für die Zukunft“ ist inspiriert von Ihrer Geschichte. Erkennen Sie sich in der Figur Franziska Schlüter wieder?
Ja, weil sie viel Empathie hat und auch aus dem Bauch und mit dem Herz entscheidet und nicht nur mit dem Kopf. Anders als bei Franziska war es bei mir im Büro allerdings nicht klamm, zum Glück. Ich hatte mir einen bestimmten Betrag reserviert, der sozusagen zu Beginn der selbständigen Tätigkeit „Spielgeld“ war. Nur hatte ich keinerlei Ahnung davon, eine Kanzlei zu führen. Das war der Sprung ins kalte Wasser. Ich übernahm in einer Sozietät den Büroraum und die Mandate eines verstorbenen Kollegen. Es war ein guter Start, weil alles da war. Nur stellte sich nach zwei Monaten heraus, dass mein Vorgänger keine Zulassung mehr hatte, und der andere Kollege – sehr vornehm und aus bester Bonner Familie – wegzog, weil dessen Bruder – der Dritte im Bunde – wieder angefangen hatte zu trinken. Ein bunter Start also. Da gibt es Ähnlichkeiten zu Franziska. Anders als sie habe ich meine Entscheidung aber nie hinterfragt. Ich war mir sicher, dass ich genau dort angekommen war, wo ich hingehöre. Und das bin ich mir heute noch, auch wenn ich – so wie gerade – sonntags in einem heißen Büro sitzen muss.

Das aufrüttelnde WDR/ARD-Drama ist inspiriert von der wahren Geschichte der Bonner Anwältin Beatrix Hüller (im Bild links). Das Foto zeigt sie zusammen mit Hauptdarstellerin Henny Reents während einer Drehpause.
© WDR/Zeitsprung Pictures/Guido En
Was hat Sie dazu veranlasst, mit Jörg Lühdorff zusammenzuarbeiten? Waren Sie gleich Feuer und Flamme oder gab es Bedenken?
Ich mache schon lange Presse- und Medienarbeit, um die Menschen aufzurütteln und ihnen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind und sich wehren sollen.
Sie geben zum Beispiel Zeitungsinterviews ...
Ja, und in Christoph Lütgerts Reportage „Die Nein-Sager“ habe ich auch mitgemacht. Als sich Herr Lühdorff bei mir meldete, hatte ich mich allerdings gerade für zwei Jahre an ein Projekt gebunden, weshalb er warten musste – und das hat er tatsächlich getan. Nach den zwei Jahren war ich gerne bereit, mitzuwirken. Ich fand es eine tolle und mutige Idee, das Thema in einen Spielfilm umzusetzen. Bedenken hatte ich gar keine. Ich fand die Zusammenarbeit dann auch sehr angenehm, spannend und fruchtbar.
Im Film klagt ein Unfallopfer gegen die zahlungsunwillige Versicherung. Für den Laien gibt es gar keine Zweifel daran, wer hier im Recht ist. Haben Sie oft mit solchen Fällen zu tun und wie groß sind die Erfolgsaussichten?
Natürlich habe ich ständig mit diesen Fällen zu tun. Zum Glück kommen die Versicherten inzwischen frühzeitig und nicht erst, wenn das Kind im Brunnen ist. Und letztlich kocht ein Versicherer auch nur mit Wasser. Mir fehlt der Respekt, da ich das System von innen heraus kenne, und das ist wahrscheinlich sehr hilfreich dabei. Ich habe auch über die Jahrzehnte ein sehr sicheres Gefühl dafür entwickelt, was auf meinen Spezialgebieten durchsetzbar ist und was nicht. Da ist es mitunter besser, einen Vergleich mitzunehmen, als bis zum bitteren Ende alles durchzukämpfen. Vor allem muss man auch die Menschen sehr gut im Blick behalten, was sie aushalten können, vor allem mental. In dem Fall, der dem Film zugrunde lag, hätte ich aber auch nicht bei den 80.000 Euro zugeschlagen, sondern weiter gemacht. Was zermürbt, ist die lange Bearbeitungsdauer, so auch bei Gericht.
Gab es bei Ihnen den einen Augenblick, der Sie die Seite hat wechseln lassen, weg von der Versicherung, hin zum Anwaltsberuf, oder war das ein längerer Prozess?
Ich kam nach zehn Jahren Ausbildung mit der Befähigung zum Richteramt in die Leistungsabteilung Berufsunfähigkeit und Unfallversicherung, wobei ich die naive Vorstellung hatte, kranken Menschen rasch helfen zu können. Ich habe aber recht schnell gelernt, dass dies nicht meine Aufgabe war. Es gab keine Auflagen in dem Sinne, sondern man hat gelernt, beständig nachzufragen, abzulehnen, weniger auszuzahlen und so weiter. Das war anfangs ein regelrechter Sport, wenn die Fälle weggelegt werden konnten, weil sich keiner gewehrt hat. Damals hatte man Textbausteine mit Kennziffern, anhand derer man die Ablehnungen produziert hat. Die Ziffern musste man nur eingeben. Man hätte aber auch nachfragen können. Dann wäre es sicher in vielen Fällen anders ausgegangen.
Hat Sie das verändert?
Mir selbst ist die Veränderung in mir nicht aufgefallen; es waren meine mittlerweile längst verstorbenen Eltern, die mich gefragt haben, was mit mir los sei; ich wäre gar nicht mehr fröhlich. Dabei war ich eine junge Frau Anfang 30. Da habe ich in mich hinein gehorcht und festgestellt, wie sehr mich das belastet hat, ständig diese Ausreden in Versicherungssprech am Telefon oder Briefen, warum man noch nicht oder gar nicht zahlen könne. Ein Fall mit einem HIV-Infizierten hat dann das Fass zum Überlaufen gebracht. Ich hatte den Fall als Urlaubsvertretung betreut und die weinende Ehefrau am Telefon, die mich angebettelt hat, doch endlich anzuerkennen und zahlen. Dabei ging es um viel Geld, so dass ich mir ein Okay von meinem Vorgesetzten einholen musste. Der wiederum gab mir auf, noch einen Arztbericht einzuholen, der völlig unsinnig war. Ich musste das dann der weinenden Frau verkaufen und als Mitarbeiterin dahinterstehen. Das war für mich der Moment, aus der Leistungsabteilung auszusteigen, sozusagen die Initialzündung. Der Fall hatte sich dann leider auch „biologisch erledigt“, wie es im Film einmal heißt, der Mann ist gestorben.
Gibt es noch weitere Versicherungsmitarbeiter*innen, die diesen Schritt gegangen sind?
Das weiß ich nicht. Das sagt man ja auch nicht unbedingt in der Öffentlichkeit. Es wirkt wie eine Schwäche, aber in der Nachbetrachtung ist es genau das Gegenteil, nämlich eine Stärke: aus einem sicheren Arbeitsplatz auszusteigen und sich auf die Gegenseite zu schlagen mit allen Unwägbarkeiten, die das mit sich bringt.
In „Verunsichert – Alles Gute für die Zukunft“ haben Sie einen Gastauftritt als Richterin. Wie kam es dazu?
Herr Lühdorff hat mich irgendwann gefragt, nachdem ich schon einmal am Set war, ob ich nicht mitspielen wolle. Ich hätte das auch selbst gefragt, aber er kam mir zuvor. Ich hatte schon ein bisschen Erfahrung durch die Zusammenarbeit mit Herrn Lütgert und durch andere Drehs etwa für die WDR Servicezeit. Dass eine so kleine Szene derart oft wiederholt werden muss, war mir neu. Ich habe Karoline Bär bewundert, die in der Rolle der Judith Broichhausen diese emotionale Schlüsselszene x-mal spielen musste.
Würden Sie noch einmal in so einem Film mitspielen?
Ich hatte eine wunderbare Rolle und konnte das Unrecht im wahrsten Sinne des Wortes richten. Etwas Schöneres kann ich mir in dem Zusammenhang gar nicht vorstellen. Ich würde das jederzeit wieder machen, sofern es die Kanzleiarbeit zulässt und solange es hilft, dass die Versicherten aufgerüttelt werden und sich wehren und durchhalten.
Das Verhalten der Versicherungen empört Sie noch immer?
Ich bin im Juli 60 Jahre geworden, und es ist mitnichten so, dass mein Fell dicker geworden ist. Im Gegenteil, es ficht mich immer mehr an, wenn die Gegenseite mit unfairen Mitteln kämpft oder alles verzögert. Und viele Gerichte das dann auch noch tolerieren.
Stand: 17.08.2020, 12.00 Uhr