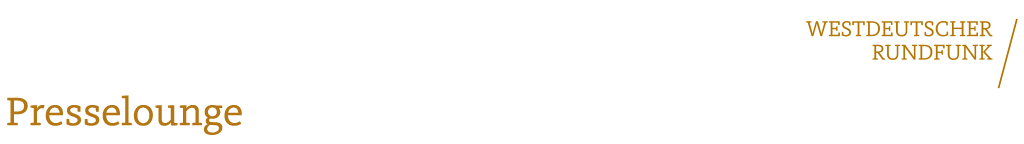Die Verhandlung - Director‘s Note
Die Verhandlung - Director‘s Note
„Wie ein Ereignis darstellen, das man nicht filmen kann?“ – Dies war eine der vielen Fragen, mit denen die Produzentin Antje Boehmert und ich uns vor Beginn des Loveparade-Verfahrens auseinanderzusetzen hatten. Bekanntermaßen sind in Deutschland Film- und Tonaufnahmen während einer Gerichtsverhandlung nicht erlaubt. Es gibt viele gute Gründe für dieses Bilderverbot. Die Herausforderung für die Filmemacher wird dadurch allerdings nicht geringer.
Zwei Voraussetzungen galt es zu erfüllen: Wir mussten über ein vollständiges eigenes Protokoll des gesamten Verfahrens verfügen, um sicher nachvollziehen zu können, was an jedem einzelnen der insgesamt 184 Prozesstage im Saal verhandelt worden ist. Denn auch hier unterscheidet sich das deutsche Rechtsystem von dem anderer Länder – es gilt das Mündlichkeitsprinzip, das heißt in eine Bewertung des Gerichts kann nur einfließen, was zuvor mündlich vorgetragen, also „eingeführt“ worden ist. 3562 Seiten umfasste am Ende unser Gesamtprotokoll, was bedeutet, dass jeder einzelne Verhandlungstag im Durchschnitt auf rund 19 Seiten dokumentiert worden ist. Dieses Protokoll bildete für uns die Basis unserer erzählerischen Überlegungen. Gleichzeitig war es die notwendige Rückversicherung, auf die wir unsere Chronik jederzeit stützen konnten.
Die zweite Voraussetzung für unseren Film war die Möglichkeit, Bilder im Verhandlungssaal drehen zu können. Reguläre Dreharbeiten konnten an Verhandlungstagen nur in den 15 Minuten vor Beginn der Verhandlung stattfinden, in der Regel also zwischen 9:15 Uhr und 9:30 Uhr. Zu dieser Zeit befanden sich meistens schon etliche Verfahrensbeteiligte im Saal: Zeugen, Nebenklagevertreter, Verteidiger, Angeklagte. Letztere zu zeigen war aus Gründen des Persönlichkeitsrechts strengstens untersagt.
Die Bilder, die in diesen vielen knappen Viertelstunden entstanden, waren durch die abgebildeten Menschen wie mit einem Zeitstempel versehen – es war jederzeit überprüfbar, wer an welchem Tag im Saal anwesend war und wer nicht.
In der Montage konnten diese dokumentarischen Bilder also nur bedingt losgelöst von ihrer chronologischen Ordnung verwendet werden. Deshalb schien es uns unerlässlich, auch außerhalb der Verhandlungstage Bilder vom leeren Saal zu drehen und mit diesen Aufnahmen das Geschehen im Saal zu re-inszenieren.
Schließlich bedurfte es auch noch eines erzählerischen Kniffs, der in der Theaterwissenschaft unter dem Begriff „Mauerschau“ oder „Botenbericht“ bekannt ist: Der mündlichen Nacherzählung eines Ereignisses, das aus praktischen Gründen auf der Bühne nicht dargestellt werden kann.
Diese Botenberichte liefern in unserem Film verschiedene Akteure und Beobachter des Verfahrens: Indem sie schildern, was wir nicht zeigen konnten, erzeugen sie im Zuschauer innere Bilder, eine Art „Kopfkino“, geboren aus der dokumentierten Wirklichkeit des Verfahrens.
Aus diesen drei Elementen – dokumentarischen Aufnahmen, inszenierten Bildern, (Boten-) Berichten – haben wir die Chronik dieses komplizierten Verfahrens entwickelt. Interessiert hat mich dabei nicht die spezielle Perspektive einer einzelnen Partei. Stattdessen haben wir versucht, möglichst viele erzählerische Zugänge zu finden.
In der abschließenden Bewertung der Ursachen für die Katastrophe von Duisburg spricht die 6. Große Strafkammer von einem „multikausalen Geschehen“. Ich hoffe, es ist uns gelungen, in Entsprechung dazu eine multiperspektivische filmische Erzählung zu schaffen.
Dominik Wessely
Stand: 17.07.2020, 11.00 Uhr